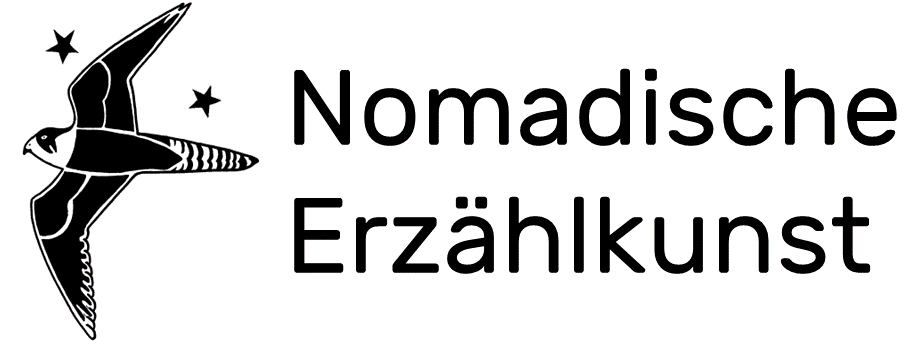Die erzählende Landschaft
Das Fundament der Erzählkunst ist eine besondere Art des Zuhörens. Wir finden sie heute noch in manchen oralen indigenen Kulturen, deren Angehörige Fähigkeiten entwickelt haben, die in unserer modernen Gesellschaft unvorstellbar erscheinen…
Walk lightly on Mother Earth
Onondaga Sprichwort
for you are walking on Grandmother’s back.
Der Sog des Stillen Ozeans
Mau Piailug war noch keine fünf Jahre alt, als er zum ersten Mal den Sog des Stillen Ozeans spürte: Er planschte in einem der felsigen Gezeitentümpel, von denen es auf Satawal so viele gab. Dabei war Satawal nur eine winzige Koralleninsel zwischen vielen anderen in Mikronesien. Sein Großvater Raangipi, später sein Vater Orranipui, lehrten ihn die Kunst der traditionellen Navigation, die in weiten Teilen Ozeaniens fast ausgestorben war. Mau, dessen Name „der Starke“ bedeutet, durchlief mit achtzehn Jahren die Pwo-Zeremonie, in der er zum Meisternavigator initiiert wurde, der in der polynesischen Kultur höchstes Ansehen genoss.
Am 1. Mai 1976 bestieg Mau im kleinen Hafen von Honolua auf Hawaii die Hōkūle‘a zur Jungfernfahrt, ein 19 Meter langes Zweimast-Segelkanu nach traditioneller polynesischer Bauart. Die Crew hatte zur Navigation keine Seekarten, keinen Kompass und auch sonst keinerlei technische Hilfsmittel an Bord, sie hatte nur Mau. Ein Meisternavigator brauchte keine Hilfsmittel, denn er verstand die Sprache des Ozeans.
Die Formen der Wolken und die Besonderheiten der Dünung, die in der Weite zu sehen und im Rumpf des Bootes zu spüren war, genügten ihm und nachts wiesen ihm die Sterne den Weg. Tag und Nacht, durch Hitze und Stürme navigierte Mau über das offene Meer. Am 4. Juni, nach 35 Tagen auf See, liefen sie im Zielhafen Pape’ete ein – im 4.200 km entfernten Tahiti. Die halbe Bevölkerung hatte sich dort versammelt, 17.000 Menschen begrüßten die Crew die Hōkūle‘a – und mit ihr die Auferstehung eines großen kulturellen Erbes. Denn es waren Reisekanus wie dieses, mit denen die Menschen im 11. Jahrhundert aus Tahiti aufgebrochen sein mussten, um Hawaii zu besiedeln.
Die erzählende Landschaft
Diese Begebenheit liefert ein sehr eindrucksvolles Beispiel dafür, was man sich unter einer „erzählenden Landschaft“ vorstellen kann. Zugegeben – der Begriff „Landschaft“ mag in Verbindung mit dem offenen Meer etwas seltsam erscheinen. Doch davon abgesehen würden die meisten von uns auf dem offenen Meer ohnehin nur Wasser, Himmel und Wolken sehen und das Auf- und Ab der Dünung spüren. Natürlich sah und spürte Mau das Gleiche, aber im Gegensatz zu uns empfing er mit diesen Eindrücken noch weitere (offenbar sehr präzise) Informationen. Wie kann das sein?
Erstens hatte Mau eine entsprechende Ausbildung genossen und verfügte über das Wissen, die Fertigkeiten und langjährige Erfahrung in der Wellennavigation.
Zweitens war Mau mit einer sehr ausgeprägten und gut trainierten Wahrnehmung ausgestattet.
Drittens – und das ist ein entscheidender Punkt – akzeptierte er, dass das Meer zu ihm sprach.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass Angehörige oraler indigener Gemeinschaften unter „Sprache“ grundsätzlich etwas anderes verstehen als die Linguistik.
In der modernen westlichen Zivilisation herrscht ein sehr anthropozentrisches Weltbild. Es gibt zum Beispiel eine klare Trennung zwischen Mensch und Natur und demzufolge wird „Sprache“ als eine Fähigkeit der menschlichen Kommunikation betrachtet. Das ist in den erdverbundenen Philosophien indigener Völkern nicht der Fall. Hier ist der Mensch nur eine von zahlreichen Ausprägungen der Natur und demzufolge verfügt neben dem Menschen auch alles andere in der Natur über ein gewisses Ausdrucksvermögen, eine „Sprache“.
Der Kulturanthropologe David Abram drückt das so aus:
„Die Erzählungen solcher Kulturen zeugen also von der einzigartigen Kraft bestimmter Bioregionen und davon, wie bestimmte Lebensräume auf je eigene Weise an die menschliche Gemeinschaft appellieren. Solche Erzählungen liefern jedoch oft auch Hinweise auf bestimmte Stätten innerhalb dieser größeren Regionen. In der Welt mündlich geprägter, indigener Völker können Erzählungen, bei denen verschwiegen wird, wo sich diese Ereignisse zugetragen haben, bereits als kraft- und wirkungslos gelten.
Die einmalige Magie eines Orts wird an den Ereignissen sichtbar, die sich dort abspielen, und dem, was einem selbst oder anderen im Umfeld jenes Orts widerfährt. Von solchen Begebenheiten zu erzählen, impliziert immer auch, von der spezifischen Kraft jener Stätten zu erzählen und an ihrer Ausdruckskraft teilzuhaben. Die zu einer Stätte gehörenden Gesänge verbindet ein gemeinsamer Stil und ein dem Puls des Orts entsprechender Rhythmus, der darauf eingestimmt ist, wie die Dinge dort zu geschehen pflegen […].
Jeder Platz hat seine eigene Dynamik und seine eigenen Bewegungsmuster, und diese Muster beanspruchen und verbinden die Sinne auf bestimmte Weise und rufen verschiedene Stimmungen oder Bewusstseinszustände hervor, so dass es in schriftlosen oralen Kulturen zu Recht heißt, jeder Ort besitze seinen eigenen Geist, seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Intelligenz.“

Ohne Orte keine Orientierung
Abgesehen vom praktischen Nutzen der Navigation liefert die Geschichte aber auch ein gutes Beispiel, wie intensiv die Verbindung von Menschen zu dem Ort oder der Gegend sein kann, in der sie leben. Und genau diese Qualität der Verbindung scheint uns durch unsere heutige Lebensweise größtenteils verloren gegangen zu sein.
In einer globalisierten, digitalisierten, hochmobilen Welt spielen Orte mit ihren Eigenheiten jedenfalls kaum eine Rolle. Das ist verhängnisvoll, denn Digitalisierung und Künstliche Intelligenz brauchen tatsächlich keinen bestimmten Ort. Menschen dagegen schon.
Computer funktionieren auf dem Mond oder im Orbit genauso gut wie auf der Erde. Menschen nicht.
Ein grundlegendes Wissen über ökologische Zusammenhänge und ein Verständnis dafür, welche Konsequenzen unsere Visionen, Pläne und Handlungen für die Erde haben, die wir offenbar trotz aller Technologie zum Leben brauchen, dürfte unserem Überleben sehr förderlich sein.
Ein solches Verständnis wird maßgeblich geprägt durch Geschichten und durch die Art und Weise, wie wir diese Geschichten erzählen.
Wenn zum Beispiel die deutsche Bundesregierung erklärt „Wir wollen internationale Standards mit setzen und globale Aufgaben durch digitale Innovationen besser bewältigen“ und diese Strategie als „alternativlos“ dargestellt wird, so handelt es sich dabei um eine Geschichte. Wenn unsere Kinder künftig in der Schule dazu genötigt werden, mit VR-Brillen herumzulaufen, „damit sie besser für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind“, so handelt es sich dabei um die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird.
Physische Orte oder überhaupt irgendetwas, womit wir uns verbinden könnten, spielen darin allerdings keine Rolle und zur Verdeutlichung und Wertschätzung ökologischer Zusammenhänge gibt es zweifellos auch andere (wir glauben: sinnvollere) Lösungsansätze, die keinerlei „Virtual Reality“ bedürfen. Und das betrifft sowohl die Geschichten, als auch die Art und Weise, wie wir sie erzählen wollen.
Andere Wege der Erdbetrachtung
„Kann es sein, dass jener Blick auf die Welt, der uns während der Nutzung einer GPS-Navigation suggeriert wird, zutiefst unsere Vorstellung davon prägt, was die Erde zu sein habe?“, fragt der Geograf Stefan Sylla in Ausgabe 53 der Zeitschrift Oya und überlegt weiter: „Zahlreiche Beispiele indigener Völker zeigen uns, dass es Wege der Erdbetrachtung gibt, die auf einem hohen Maß an bewusster Verbundenheit mit den Orten, von denen sie erzählen, gründen. Wenn ich heute allerdings mehrere Tausend Jahre alte polynesische Beschreibungen der Meeresströme, die Songlines der australischen Aborigines oder gemalte Landschaftserzählungen der nordamerikanischen Ersteinwohner betrachte, erscheinen sie mir unzugänglich, denn ich kenne nicht die Geschichten und besitze nicht die Augen, die nötig sind, um die Welt aus diesen Perspektiven zu begreifen und das tiefe Wissen zu entdecken, das darin verborgen liegt.“
In der Tat verlieren unsere seltsam ortslosen Geschichten von Technologie verblüffend schnell an Strahlkraft, wenn wir uns mit einigen Problemlösungsstrategien verschiedener indigener Völker vertraut machen – also jener Kulturen, deren Angehörige eine sehr intensive Verbindung zu ihrer Mitwelt hatten bzw. haben. Um nahe an den von Sylla genannten Beispielen zu bleiben:
Die nautische Kunst der Polynesier (Oezanien)
Der Navigator genießt in der polynesischen Kultur höchstes Ansehen. Die Kunst der Navigation ist ein wohlgehütetes Geheimnis, das in einem mehrjährigen Prozess an die Schüler der nachfolgenden Generation weitergeben wird. Während wir zum Navigieren auf See technische Hilfsmittel wie Seekarte, Kompass oder Satellitennavigation nutzen, kann sich ein ausgebildeter, erfahrener indigener Navigator tatsächlich allein anhand der Dünung orientieren!
Während der Ausbildung werden sogenannte Stabkarten zur Vorbereitung der Fahrten genutzt, deren Stäbe die Dünungen um die Inseln anzeigen, z. B. wie sie von den Inseln gebogen, abgelenkt oder reflektiert werden. Kabbelungen (das Aufeinandertreffen verschiedener Dünungen) erzeugen Bereiche unruhiger See, die wie ein Fingerabdruck einzigartig und unveränderlich für ein bestimmtes Gebiet sind. Zwar werden sie oft von den örtlichen Winden und Stürmen überlagert, aber nie völlig verdeckt. Die Fahrtrouten führten dann meist nicht in gerader Linie zum Ziel, sondern entlang der Grate von zwei sich überschneidenden Dünungen.
Die Songlines der Aboriginals (Australien)
Die Kulturen der verschiedenen Aboriginal-Völker sind vermutlich die ältesten noch existierenden menschlichen Kulturen. Die frühesten australischen Funde werden auf ein Alter von 40.000 bis 60.000 Jahre geschätzt. Mit rudimentären Werkzeugen (hauptsächlich Grabstock, Bumerang und Jagdspeer) haben sich die Kulturen der Ureinwohner im unwirtlich heißen und trockenen Outback eine geradezu unglaubliche Beständigkeit bewahrt (erst die Besiedelung durch die Briten brachte sie in große Bedrängnis).
Den Schöpfungsgeschichten dieser Kulturen zufolge ist der gesamte Kontinent von sogenannten „Songlines“ (Traumpfaden) durchzogen, auf denen in der Traumzeit die Ahnenwesen „erstmals aus ihrem Schlummer unter dem Erdengrund erwachten und begannen, sich auf der Suche nach Nahrung, Obdach und Gesellschaft ihren Weg durch die Landschaft zu singen“, wie Abram beschreibt.
Dabei ist die Traumzeit nicht etwa die Vergangenheit, sondern eine völlig andere Art von Zeit, „die sich jenseits oder sogar innerhalb der offensichtlichen, manifesten Präsenz der Landschaft verbirgt. Sie ist eine magische Zeitlichkeit, in der die Kräfte der uns umgebenden Welt einst ihren Platz fanden und die sichtbaren Formen annahmen, durch die sie uns noch heute vertraut sind. Sie ist eine Zeit […], die nach wie vor und weiterhin unter der Oberfläche unseres Wachsbewusstseins existiert.“
Da die Ahnenwesen auf ihrer Wanderung dem Land die Namen der Dinge und Orte „einsangen“, ist eine Songline so etwas wie eine „Klangspur“, die das Land durchzieht. Abram beschreibt das als „einen ausgedehnten, epischen Gesang, dessen Strophen von den zahlreichen Abenteuern des Ahnenwesens künden und davon, wie einst die vielen Orte entlang des Pfades entstanden“.
Eine Songline hat immer die gleiche Grundmelodie und die verschiedenen geografischen Abschnitte finden sich in Form von verschiedenen Strophen wieder. Diese wiederum enthalten neben der akustischen Beschreibung der Topografie noch unzählige weitere Informationen, wie z. B. darüber, welche Heilpflanzen, Wasserquellen oder Schlafplätze auf dem jeweiligen Abschnitt zu finden sind und sogar, welche Verhaltensregeln in dem Gebiet angemessen sind, durch das die Songline verläuft. Dieses Wissen wird seit Tausenden von Jahren bewahrt und weitergegeben. Gelegentlich treffen sich die Angehörigen des Clans einer Songline an einem bestimmten Ort und studieren gemeinsam den gesamten Liedzyklus aller Abschnitte ein.
Die ‚Agodzaahi-Geschichten der Apachen (Nordamerika)
Bei den Apachen-Völkern, die im amerikanischen Südwesten (Arizona) leben, spielen Ortsbezeichnungen eine sehr wichtige Rolle. Es handelt sich dabei nicht einfach nur um einen Namen wie z. B. „Berlin“, sondern um ganze Sätze, deren ebenso knappe wie präzise visuelle Beschreibung den Ort vor dem geistigen Auge entstehen lässt. Ein Ortsname kann zum Beispiel lauten: „Große Pappeln breiten hier und dort ihre Zweige aus“ oder „Wasser strömt über eine Stufenfolge flacher Felsen herab“. Die Apachen lieben derartige Ortsbezeichnungen und können ganze Ketten davon aufsagen. Durch das Aussprechen der Namen fühlen sie sich an den entsprechenden Ort versetzt und das Verketten der Ortsnamen ist gewissermaßen eine „Reise im Geiste“, ähnlich wie das Rezitieren einer Songline bei den Aboriginals.
Darüber hinaus ist die Landschaft in der Kultur der Apachen eine regelrechte Instanz, die das Verhalten der Menschen regelt. Abram beschreibt: „Die moralische Autorität der Landschaft – jene Kraft des Landes, Achtsamkeit und Respekt in der Gemeinschaft zu gewährleisten – wird über ein ganzes Genre von Geschichten vermittelt, die regelmäßig im Dorf erzählt werden.“ Diese kurzen Geschichten(‚agodzaahi: das, was geschehen ist) beginnen und enden jeweils mit einer Ortsbezeichnung und beschreiben Begebenheiten mit Menschen, deren Missachtung der Verhaltensregeln oder der Stammesmoral ihnen schweres Unglück brachte. „Heute werden solche Geschichten immer dann vorgetragen, wenn jemand in der Gemeinschaft gegen die Stammessitten verstößt. Wird die ‚Agodzaahi-Geschichte richtig erzählt, wirkt sie als rehabilitierende Maßnahme auf diesen Verstoß. […] Bei dieser einzigartigen Form gemeinschaftlicher Sanktionierung wird ein topografischer Ort zum Garanten einer Verhaltenskorrektur, zur sichtbaren Präsenz, die einen an einstige Fehltritte erinnert und künftig zu mehr Achtsamkeit anhält. Durch das Erzählen einer ‚Agodzaahi-Geschichte wird ein beinahe familiäres Band zwischen den Personen, auf die die Geschichte abzielt, und bestimmten Orten oder natürlichen Landmarken geknüpft. […]
Für eine orale Kultur ist ein bestimmter Ort in der Landschaft nie nur ein passiver oder träger Hintergrund für die menschlichen Geschehnisse, die sich dort ereignen. Der Ort ist ein aktiver Teilnehmer an diesen Ereignissen. Vermöge der zugrunde liegenden und umfangenden Präsenz des Orts mag dieser sogar als die Quelle, die ursprüngliche Kraft erfahren werden, die sich durch die verschiedenen, dort entfaltenden Geschehnisse Ausdruck verleiht.“
Diese drei Beispiele liegen sowohl geografisch als auch kulturell weit von Mitteleuropa entfernt. Wir wollen damit in keiner Weise fremde Kulturen glorifizieren oder Technologie generell kritisieren. Wir wollen auf die Art und Weise aufmerksam machen, wie wir in Mitteleuropa unsere Kultur leben und unsere Technologie nutzen. Außerdem wollen wir die Geschichten deutlich machen, die zu dieser Lebensweise führen und zeigen, dass wir genauso gut auch andere erzählen können:

Der Klang der Kälte (Daniel)
Ich bin ein Winterkind, im Februar geboren. Vielleicht lag es daran, dass ich als kleiner Bub die Kälte liebte. Klirrender Frost bedeutete nämlich auch strahlenden Sonnenschein, und außerdem konnte ich dann auf dem gefrorenen Gartenteich herumschlittern oder die Vögel am Futterhäuschen beobachten, die im Sommer nie so nahe kamen. Ich wusste immer, wann der Frost kam, denn die Kälte hatte bei uns zu Hause einen bestimmten Klang. Abends, nach dem Zähneputzen, wenn ich eigentlich ins Bett gehen sollte, schlich ich noch mal durch den Windfang, schloss die Haustür auf, stellte mich oben auf den Treppenabsatz und lauschte in die dunkle, kalte Luft hinaus. Nachts tragen die Geräusche anders als am Tag und wenn ich dort stand und das entfernte, dumpfe Rauschen der Autobahn hörte, wusste ich, dass nun der Frost kam.
Das lag ganz einfach daran, dass in unserer Gegend die Wolken und mit ihnen das milde und feuchte Wetter fast immer aus dem Westen kamen und die trockene Kälte, die ich so liebte, immer aus dem Osten. Wenn ich also das Rauschen der Autobahn hörte, die östlich von unserem Dorf durch die Felder führte, konnte ich sicher sein, dass in der Nacht der Frost kommen würde.
Diesen Vorgang der Wahrnehmung hätte ich als Kind natürlich nicht beschreiben können. Außerdem wurde er mir erst viel später bewusst, als ich nämlich woanders lebte, wo es weder einen Treppenabsatz noch eine Autobahn gab.
Die Sprache der Bäume (Kathinka)
Schon als Kind begeistert von der Natur, wollte ich am Liebsten wie die Indianer auf nacktem Pferderücken reiten, immer nur draußen schlafen und unter den Fußsohlen taufeuchtes Gras oder sonnenwarme Steine spüren. Im entsprechenden Alter nahm ich im Schwarzwald an einem Initiationsritus nach indianischer Tradition teil. Das war ziemlich genau so, wie ich es mir erträumt hatte: Es roch nach Feuer, auf den Wiesen standen Tipis, es gab gutes Essen und wir waren die ganze Zeit draußen. Bei aller Begeisterung, die ich mitbrachte, stand ich dennoch plötzlich vor einer großen Herausforderung:
Wir wurden mit einem roten Band losgeschickt, sollten uns von einem Baum finden lassen und das Band mit einem Wunsch an diesem festmachen. Und jedes Mal, wenn wir etwas von einem Baum nahmen, einen Zweig, ein paar Blätter, sollten wir erst fragen und die Antwort abwarten und uns anschließend bedanken.
Ich spürte Angst und Unsicherheit in mir aufsteigen: Wie soll ich wissen ob es richtig ist? Wie wählt mich ein Baum? Wie antwortet ein Baum? Was ist, wenn ich den Baum falsch verstehe? Lauter Fragen, auf die ich keine Antworten hatte und lauter Fragen, die ich mich nicht zu stellen traute, weil sie kein anderer stellte. Also lief ich einfach los. Ich wusste nicht, ob ich etwas spürte oder ob ich es mir nur einbildete, manchmal beschloss ich vielleicht absichtlich, dass der Baum „Nein“ gesagt hatte, obwohl ich gar keine Ahnung hatte.
Für mich waren das die ersten zaghaften Versuche im Verstehen und Sprechen einer Fremdsprache. Langsam, über viele Jahre hinweg, begann ich ein Gespür zu entwickeln für Orte, für Bäume – und lernte, diesem Gespür zu vertrauen.
Jenseits von Worten
Diese Geschichten sind vielleicht nicht so beeindruckend wie die des Meisternavigators Mau, aber es geht um das gleiche Thema: die sinnliche Erfahrung unserer Umgebung – was mit unserem heutigen modernen Lebensstil kaum noch gelingt. Die zunehmende Geschwindigkeit unseres Lebens entfernt uns jedenfalls weiter und weiter von den Mustern und Rhythmen der Natur. Was uns bleibt, ist die Freiheit, gelegentlich „unmodern“ zu leben. Das klingt nicht sehr komfortabel, doch wir eröffnen uns dadurch eine Chance, wieder den „Puls“ der Erde zu spüren, wie es der britische Mythologe und Storyteller Martin Shaw in einem Interview für die Zeitschrift Oya beschreibt:
„Wenn ein Tier einen Ruf aussendet, wird ein Echo zurückgeworfen, das auch einem beinahe blinden Wesen ein Gefühl für seine Umgebung vermitteln kann. Genau das hat die Erde immer schon getan. Sie sendet einen Puls aus – und wartet auf Widerhall. Geschichtenerzählerinnen und -erzähler sind diejenigen, die diesen Ruf hören und erwidern können: Vielleicht erreicht der Ruf einen Inuit-Fischer, der an einem Eisloch kauert, vielleicht einen Wanderer auf einem Feldweg in Wales oder eine Frau, die frühmorgens die Sommersonne zum Gärtnern nutzt. Diesem Puls können wir ablauschen, wie wir leben sollen.“
Wenn wir in unseren Geschichten mehr als nur Worte transportieren wollen, wenn wir also „wirklich“ Erzählen lernen wollen, dann sollten wir uns mit der Art und Weise des Zuhörens auseinandersetzen. Was Shaw beschreibt, ist eine sehr tiefe Art des Zuhörens und sie bildet das Fundament der Erzählkunst.
Wenn wir lernen, so zu hören, akzeptieren wir, dass alles in der Natur über Ausdrucksvermögen verfügt, egal ob Flüsse oder Wolken, Steine oder Pflanzen, Menschen oder Tiere. Wenn wir lernen, so zu hören, wird sich mit der Zeit unsere Sprache verändern. Wir werden Wege entwickeln, jene Veränderungen buchstäblich wachzurufen, die wir uns für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts erträumen.