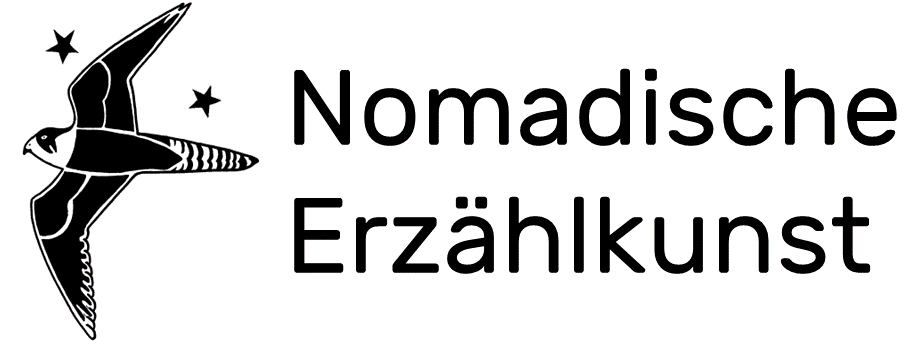Wahrheit ist wilder als Fakten
Mythen können Orientierung bieten, Widersprüche integrieren und auflösen und die Grenzen menschlicher Sprache überschreiten. Das ist sicher mehr als beeindruckend, aber nun kommen wir mal zum Punkt: Wie nähern wir uns denn als Erzähler*innen diesen Geschichten an?
Mythen sind ein wilder Weg, die Wahrheit zu sagen.
Martin Shaw
So langsam wachsen sie uns über den Kopf: Mythen können Orientierung bieten, Widersprüche integrieren und auflösen und die Grenzen menschlicher Sprache überschreiten. Was können sie eigentlich nicht? Klare Sache: Sich unterordnen.
Mythen sind keine gehorsamen Geschichten. Wirklich gar nicht.
Wenn wir eine Geschichte nicht auswendig lernen und rezitieren, sondern tatsächlich erzählen, stehen wir gewissermaßen nackt vor unserem Publikum: Alle Emotionen, alle Verletzlichkeiten und Stärken, alle Spuren, die das Leben in uns hinterlassen hat – also alles, was wir in die Waagschale werfen können – stellen wir in den Dienst der Geschichte. Und nur um es mal gesagt zu haben: Wenn du dich wirklich in den Dienst der Geschichte stellst, kannst du dich beim Erzählen nicht hinter ihr verstecken. Du leihst ihr die Kraft deiner Stimme, sie leiht dir das Gewicht ihrer Wahrheit: so läuft der Deal.
Damit wird deutlich: Wenn das funktionieren soll, musst du in der Geschichte etwas gefunden haben, was dir für dein eigenes Leben als Wahrheit gilt. Wenn du dieses Etwas nicht gefunden hast, dann hast du keinen Deal mit der Geschichte. Und dann erzählst du sie bitte nicht.
So viel zum allgemeinen Umgang mit Geschichten, wie wir ihn bei der Nomadischen Erzählkunst lehren. Aber Mythen sind nicht einfach „nur“ Geschichten. Mythen sind die Champions League. Wenn du in der Champions League der Geschichten mitspielen willst, reicht die Wahrheit deines eigenen kleinen Lebens nicht aus.
C. G. Jung (wir sind ihm bereits im Artikel „Die großen Unbekannten“ begegnet) wird der rätselhafte Satz zugeschrieben: „Es ist eine merkwürdige Tatsache, dass ein Leben, das bloß aus dem Ich gelebt wird, in der Regel nicht nur auf den Betreffenden selbst, sondern auch auf die Zuschauer als dumpf wirkt.“
Jung ging es dabei um die Frage nach unserer Identität. Sobald wir uns mit etwas identifizieren, das größer ist als wir selbst (beispielsweise unsere Familie, die Nachbarschaft oder gleich die ganze Region), wird das zu einem Teil von uns. Wir erweitern sozusagen unsere Identität, wir vernetzen unser „Selbst“ mit anderen.
Das klingt fast banal, aber die Auswirkungen sind enorm. Es gibt eine ganze Philosophie, die sich genau damit auseinandersetzt, nämlich die Tiefenökologie. Deren Gründerin, Joanna Macy, bringt die Dinge auf den Punkt:
„Gerade aus unserem vernetzten Selbst (auch Öko-Selbst) erwächst vieles von dem, was die Menschen am Leben am meisten schätzen, wie Liebe, Freundschaft, Loyalität, Vertrauen, Beziehung, Zugehörigkeit, Sinn und Zweck, Dankbarkeit, Spiritualität und gegenseitige Hilfe.“
Der Philosoph Immanuel Kant unterschied seinerzeit zwischen „moralischen Handlungen“ und „schönen Handlungen. Unter moralischen Handlungen verstand er das, was wir tun, weil unser Pflichtgefühl uns dazu nötigt. Unter schönen Handlungen verstand er das, was wir aus tiefstem Herzen und dem Gefühl der Verbundenheit tun.
Darauf nimmt Joanna Macy Bezug, wenn sie weiter erklärt:
„Wenn die Wahrnehmung von unserem vernetzten Selbst gut entwickelt ist, drängt es uns häufiger zu schönen Handlungen. Wenn wir diese Wahrnehmung davon, dass unser Selbst mit anderen verbunden ist, verlieren, dann entgeht uns diese Art von Schönheit, was tragische Folgen hat.“
Mit den „anderen“ sind übrigens durchaus nicht nur Menschen gemeint. Die Tiefenökologie befasst sich mit der Gesamtheit allen Lebens und betrachtet den Menschen lediglich als eine von vielen Arten. Indigene Kulturen erkennen auch Flüsse, Berge, Steine usw. als Personen an. Als Erzähler*innen tun wir gut daran, diese Hinweise ernst zu nehmen, auch wenn sie unserem rationalen Verstand nicht zugänglich sind.
Und nun zurück zum Deal: Während des Erzählens leihst du der Geschichte die Kraft deiner Stimme, sie leiht dir dafür das Gewicht ihrer Wahrheit. Je weiter du die Wahrnehmung deines vernetzten Selbst entwickelst, desto stärker wird die innere Kraft deiner Stimme und desto schwerer wiegt die Wahrheit der Mythen, die du erzählst.
In vielen indigenen Kulturen wird dieses Gewicht der Wahrheit auch Power genannt.
Spätestens jetzt dürfte auch klar sein, dass die Art von Wahrheit, über die wir hier sprechen, nichts mit Fakten zu tun hat. Sie ist viel größer, vernetzter, lebendiger und wilder als Fakten. Der britische Mythologe und Storyteller Martin Shaw sagt unverblümt: „Mythen sind ein wilder Weg, die Wahrheit zu sagen. Fakten sind dafür ein armseliger Ersatz.“
Mythen sind also nicht wahr, weil sie faktisch richtig wären, sondern weil sie wirken. Und ob sie wirken, hängt unter anderem mit dir als Erzähler*in zusammen.
Weiterführende Infos
- Macy, Johnstone: Hoffnung durch Handeln. Dem Chaos standhalten ohne verrückt zu werden. Paderborn 2014
- C. G. Jung: Archetypen. Urbilder und Wirkkräfte des kollektiven Unbewussten. Ostfildern 2018
- Martin Shaw: A Branch from the Lightning Tree. Ecstatic Myth and the Grace in Wildness. Devon 2011