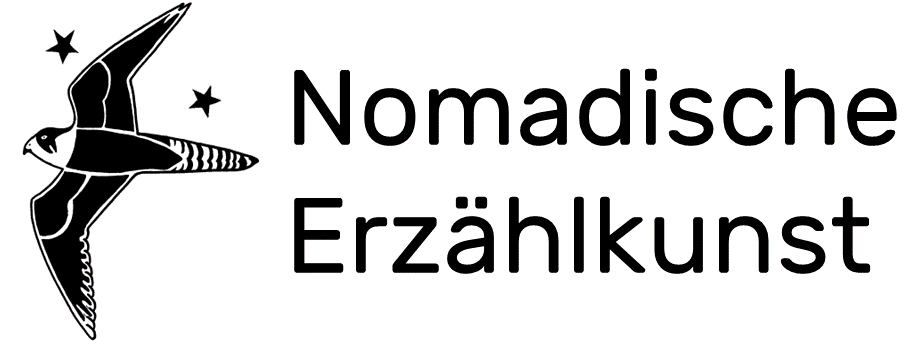Was können Mythen?
In früheren Gesellschaften hatten Mythen im Wesentlichen vier Funktionen. Wir untersuchen, welche dieser Funktionen in unserer heutigen Gesellschaft noch von Mythen erfüllt werden und welcher Handlungsrahmen sich für uns als Erzähler*innen von Mythen dadurch ergibt.
Ohne Individuen, die sich ihrer selbst bewusst sind, kann es keine bewusste Gemeinschaft geben. Und ohne eine bewusste Gemeinschaft findet das Individuum keinen Raum, sich zu entfalten.
Shelley Sacks
Die Frage nach dem Wesen der Mythen hat zu vielen verschiedenen Perspektiven geführt. Wir haben nun einen fundierten Hintergrund zu möglichen Sichtweisen. Das hilft uns als Erzähler*innen, unsere eigene Haltung zu prüfen und einzuordnen. Manche verstehen ihre Kunst als eine Form von Aktivismus, andere nicht. Wenn du aber Mythen erzählen möchtest, macht es Sinn, dir über die eigenen Motive klar zu werden.
Geschichten (besonders Mythen) haben viel mit Viren gemein. Weil sie keinen Stoffwechsel betreiben und sich auch nicht selbständig vermehren, kann man sie eigentlich nicht als lebendig bezeichnen. Sie benötigen einen Wirt. Sie schleusen ihre DNA in das Erbgut der Wirtszellen ein, wodurch diese weitere Viren-Partikel erzeugen, die wiederum weitere Zellen befallen können. Wenn das nicht so richtig klappt, können sich Viren genetisch weiterentwickeln. In gewisser Hinsicht sind sie also doch lebendig. Jedenfalls werden sie zum Bestandteil eines lebenden Systems, wenn sie sich in eine Wirtszelle integriert haben. Einige Viren sind für uns Menschen schädlich, andere so nützlich, dass wir sie in unser eigenes Genom übernommen haben.
Nun ersetzen wir Viren durch Geschichten, Wirtszellen durch Menschen, die Infektion durch den Akt des Erzählens und die DNA durch die menschliche Psyche.
Natürlich sind nicht alle Viren und alle Geschichten gleich erfolgreich. Unter all den Viren gibt es bekanntlich die Gruppe der Coronaviren, die vor einigen Jahren zu Superstars avancierten. Ein ähnliches Potenzial unter all den Geschichten hat die Gruppe der Mythen.
Joseph Campbell zufolge hatten Mythen in früheren Gesellschaften hauptsächlich vier Funktionen zu erfüllen, die man folgendermaßen zusammenfassen kann:
- Die mystische Funktion
Wenn ein kleines Kind zum ersten Mal mit leuchtenden Augen und offenem Mund einen Eiszapfen bestaunt und ihn ganz vorsichtig berührt, dann befindet es sich in einem Modus der Ehrfurcht vor der Welt und ihren Geheimnissen. Für uns Erwachsene sind Geheimnisse oft peinlich, weil sie uns vor Augen führen, was wir alles nicht wissen und deshalb suchen wir für alles eine Erklärung, wie sinnvoll sie auch immer sein mag. Aber Kinder lieben es, zu staunen. Die mystische Funktion soll diese Geisteshaltung auch uns Erwachsenen zugänglich machen. - Die kosmologische Funktion
Die zweite Funktion soll uns ein Bild von der Welt vermitteln: Wie ist sie entstanden, welche Rolle spielt sie im Weltall, wie funktioniert das Leben auf der Erde, wie hängt das alles zusammen…? Die Antworten auf solche „ganz großen“ Fragen wird Kosmologie genannt. Die kosmologische Funktion der Mythen stützt die Geisteshaltung der Ehrfurcht und des Staunens vor unserer geheimnisvollen Welt. Allerdings muss die Kosmologie auch der tatsächlichen Erfahrung, dem Kenntnisstand und der kulturellen Mentalität entsprechen, sonst wird sie nicht ernst genommen. Als erwachsene Menschen wollen wir nichts vom Klapperstorch wissen. - Die gesellschaftliche Funktion
Die dritte Funktion der Mythen besteht darin, die jeweilige Gesellschaftsordnung zu stützen, indem sie eine bestimmte Gefühlshaltung vermitteln. Dadurch wird der individuelle Mensch mehr oder weniger zwanglos an die Ziele seiner Gemeinschaft gebunden und die Gesellschaft als Ganzes kann sicher sein, dass ihre Mitglieder sich gemäß der ihr zugedachten Rollen verhalten (wie fair diese auch immer sein mögen). Je komplexer die Gesellschaft, desto schwieriger ist es natürlich, diese Funktion auszufüllen. - Die psychologische Funktion
Wir könnten sie auch pädagogische oder spirituelle Funktion nennen. Es ist eine Art „Bedienungsanleitung“ für die eigene Seele, eine Heldenreise, eine innere Suche nach unserer Lebenskraft, die uns ermöglicht, uns unter allen Umständen als Menschen zu entwickeln und somit an der Evolution teilzuhaben.
Das also waren die Funktionen, die Mythen in früheren Gesellschaften zu erfüllen hatten; dementsprechend wichtig waren sie.
Wenn wir nun überprüfen, welche dieser Funktionen in unserer heutigen Gesellschaft noch von Mythen geleistet wird, ergibt sich ein ziemlich chaotisches Bild:
- Spätestens seit dem Zeitalter der Aufklärung ist Staunen out. Wenn wir überhaupt noch vor irgend etwas Ehrfurcht haben, dann vor den Leistungen der eigenen Vernunft – auch wenn wir dazu (vernünftig betrachtet) im Moment wenig Grund haben. Ehrfurcht ist also grundsätzlich schon noch vorhanden, sie richtet sich nur auf andere Dinge als vorher.
- Die kosmologische Funktion wird heute scheinbar von der Wissenschaft übernommen – gemäß den Erfahrungen unserer Lebenswelt und unserem Kenntnisstand. Allerdings befindet sich die kulturelle Mentalität gerade im Wandel: Als Gesellschaft behaupten wir zwar, unsere Entscheidungen auf der Basis von Fakten zu treffen, doch zunehmende Teile der Bevölkerung lassen sich inzwischen jeden Blödsinn als Fakten verkaufen. Die Wissenschaft hat dem Mythos also die kosmologische Funktion abgenommen, aber nicht ausgefüllt. Es gibt gewissermaßen ein „Welterklärungs-Vakuum“.
- Die Gesellschaftsordnung ist gerade ein ziemliches Durcheinander und es finden größere gesellschaftliche und auch internationale Verschiebungen statt. Die Diskussionen darüber werden zunehmend hitzig geführt: Der Mythos des starken Mannes, der die Ordnung wiederherstellt und den Erfolg sichert, wird mit zunehmender Aggression gegen die Angst vor der Unsicherheit kommender Zeiten verteidigt. Auch hier gibt es ein gefährliches Vakuum.
- Bis hierher haben die Mythen ziemlich Federn gelassen. Die psychologische Funktion ist aber heute wichtiger als je zuvor. Campbell beschreibt, dass der humanistische Individualismus Schaffenskräfte freigesetzt habe, „durch die in nur zwei Jahrhunderten Veränderungen im Wohl und Wehe der Menschen herbeigeführt wurden, wie sie davor keine zwei Jahrtausende jemals bewirkt hatten. Das Ergebnis ist, dass die alten Moralbegriffe dort, wo man noch an ihnen festhält, nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten am Ort gerecht werden, ganz zu schweigen von den weltweiten. Das Gralsabenteuer, die innere Suche nach jenen schöpferischen Werten, durch die das wüste Land erlöst wird, ist heute für jeden eine unumgängliche Aufgabe geworden.“
Wie gesagt: Ein ziemliches Durcheinander. Zum Teil sind Funktionen, die für den Fortbestand einer Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind, überhaupt nicht mehr ausgefüllt, weder von den Mythen noch von sonst irgendetwas. Das führt uns als Erzähler*innen allzu leicht zu der Frage, welche Relevanz Mythen heute überhaupt noch haben.
Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass sich im Verlauf der Menschheitsgeschichte Gesellschaftsformen schon oft verändert haben – Menschen aber nicht. Sowohl körperlich als auch seelisch sind wir im Wesentlichen die Gleichen geblieben – durch alle Zeitalter und auf allen Erdteilen.
Wir können also davon ausgehen, dass die psychologische Funktion der Mythen von all den äußeren Umwälzungen und Veränderungen weitgehend unbeeinflusst geblieben ist – und das ist ein wichtiger Hinweis zum Handlungsrahmen, den wir als Erzähler*innen haben: Indem wir Mythen erzählen, helfen wir Menschen, sich ihrer selbst bewusst zu werden.
Je nach Perspektive wirkt diese Erkenntnis enttäuschend oder befreiend. Es ist weder unsere Fähigkeit noch unsere Aufgabe, als Erzähler*innen die ganze Welt zu retten. Doch indem wir Mythen erzählen, können wir den individuellen Menschen, die wir erreichen, wichtige Orientierungspunkte anbieten.
Die britische Künstlerin Shelley Sacks, inspiriert von Beuys’ Konzept der „sozialen Plastik“ drückt das so aus: „Ohne Individuen, die sich ihrer selbst bewusst sind, kann es keine bewusste Gemeinschaft geben. Und ohne eine bewusste Gemeinschaft findet das Individuum keinen Raum, sich zu entfalten.“
Weiterführende Infos
- Joseph Campbell: Die Masken Gottes. Band 3: Mythologie des Westens. Basel 1992
- Joseph Campbell: Die Masken Gottes. Band 4: Schöpferische Mythologie. Basel 1992
- Hildegard Kurt: Wachsen! Über das Geistige in der Nachhaltigkeit. Stuttgart 2010