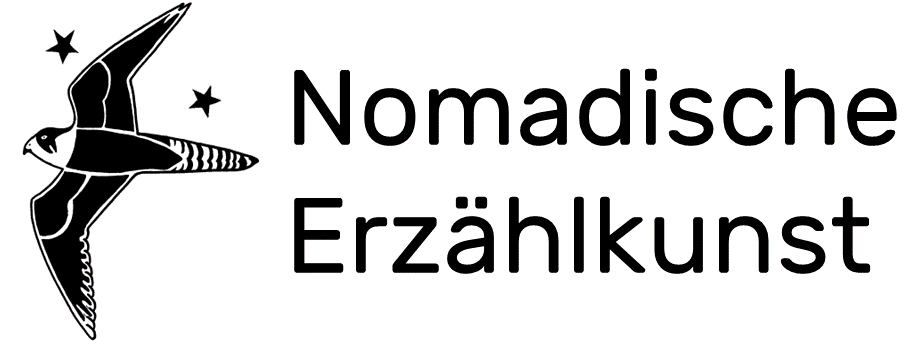Gestalten gestalten
Zerlegen oder zusammenfügen? Mehr Details oder mehr Zusammenhänge? Können wir lernen, die Welt zu verstehen, ohne oberflächlich zu werden oder uns in Details zu verlieren? Wie stellen wir es an, nicht die Orientierung zu verlieren? Ein Überblick über den Gestalt-Begriff aus erzählerischer Sicht.
Du wirst ihn tagelang nicht los. Er nervt dich unglaublich und du kannst ihn nicht mehr hören. Aber du kannst auch nicht von ihm lassen. Er begleitet dich mit sanfter Penetranz überall, egal wo du gerade bist, sogar in den Schlaf. Die Rede ist vom Ohrwurm!
Wir kennen das: Wenn wir uns einen Ohrwurm eingefangen haben, reichen womöglich die ersten drei, vier Töne – und schon steht das ganze Lied wieder vor uns und spult sich selbständig ab.
An dieser Stelle muss ich zugeben, dass ich Ohrwürmer nicht besonders gerne mag. Trotzdem finde ich sie irgendwie faszinierend. Mit ihrer Hilfe lässt sich nämlich die Bedeutung eines abgedroschenen Spruchs gut erklären: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. Genau genommen ist dieses Sprichwort sprachlich unpräzise und müsste richtig heißen „das Ganze ist was anderes als die Summe seiner Teile“.
Außerdem hinkt der mathematische Vergleich ziemlich, denn in welcher Reihenfolge ich Zahlen zu einer Summe addiere, ist in der Mathematik egal. In der Musik ist das nicht egal. Eine Melodie besteht zwar aus Tönen, aber wenn wir die Töne in einer anderen Reihenfolge zusammensetzen, entsteht – nunja – ein andere Melodie.
Und damit zurück zum Ohrwurm: Wenn wir die ersten Töne einer uns bekannten Melodie hören, dann sind das für uns bereits Teile eines Ganzen Und für dieses „Ganze“ wird spätestens seit Laura und Fritz Perls der Begriff „Gestalt“ verwendet, der aus der Wahrnehmungspsychologie kommt. Wenn wir die Gestalt kennen, dann gibt das Ganze eben auch jedem Teil etwas von seinem Charakter mit. Ganzes und Teil sind innerlich miteinander verbunden.
Eigentlich ist das nicht so schwer zu verstehen, dennoch haben wir in unserer spätmodernen westlichen Welt damit gewisse Probleme. Der Alternative Nobelpreisträger Hans-Peter Dürr beschrieb das seinerzeit so:
„In einer Welt, in der wir gelernt haben, immer schärfer zu fokussieren und deshalb immer mehr Einzelheiten wahrzunehmen, haben wir immer größere Schwierigkeiten, den Gesamtzusammenhang zu verstehen. Wir laufen deshalb heute große Gefahr, den Überblick und damit die Orientierung zu verlieren.“
Dürr hatte als Quantenphysiker das Max-Planck-Institut in München geleitet und war mehr als einmal an die Grenzen der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise gestoßen.
In seinen Ausführungen beschreibt er, dass in unserer heutigen Gesellschaft Exaktheit, also die Schärfe einer Aussage, einen sehr hohen Wert hat und wir von unserer Wahrheitsfindung verlangen, dass sie zu eindeutigen Ergebnissen führt.
Allerdings, so Dürr, sei die Wirklichkeit nicht kompliziert, sondern komplex, und der Erfolg der Naturwissenschaft beruhe im Wesentlichen darauf, die Komplexität näherungsweise als Kompliziertheit zu interpretieren und dann mithilfe von Analyse, Zerlegung und Fragmentierung in mund- bzw. hirngerechte Brocken zu zerkleinern.
In dem Maß, in dem wir diese Schärfe aufgeben, kommt auch die Gestalt, also die Bedeutung (die Beziehungsstruktur) wieder zum Vorschein.
Der norwegische Philosph Arne Næss, der als Mitbegründer der „Tiefenökologie“ gilt, beschreibt, wie die nepalesischen Sherpa den Begriff „Tseringma“ verwenden: Damit wird sowohl eine Göttin als auch ein 7.000 m hoher Gigant aus Fels und Eis bezeichnet, der an der Grenze zu China steht. In einem solchen Fall würden wir von einem mehrdeutigen Begriff sprechen. Das wiederum fänden die Sherpa befremdlich, denn „Tseringma“ ist für sie ein übergeordneter Begriff – eine Gestalt.
Næss erklärt, dass solche übergeordneten Einheiten als mythisch bezeichnet werden. In „Die Zukunft in unseren Händen“ schreibt er:
„Wenn wir einmal akzeptieren, dass sich solche Benennungen vor allem auf Gestalt-Kontexte beziehen, wird das mythische Denken gleich viel verständlicher. Und wenn wir erst einmal begriffen haben, dass es Kulturen gibt, in denen vor allem die Gestalten und nicht die Bestandteile der Gestalten als Inhalte der Wirklichkeit gelten, dann wird uns auch klar, dass das mythische Denken auf Inhalte Bezug nimmt, die in unserer eigenen Kultur so nicht vorkommen.“
Wir sind also wesentlich geübter darin, mit unserem Denken zu zerlegen als zusammenzufügen. Die gute Nachricht ist: Neurobiologisch besteht dafür keine Notwendigkeit; unser Gehirn beherrscht grundsätzlich beide Denkweisen – es handelt sich dabei eher um eine Frage der Sozialisation.
Ich möchte sogar behaupten, dass wir auch eine Sehnsucht nach diesem mythischen Denken haben. Die wird jedoch immer wieder regelrecht abgewürgt von einer Denkweise, die gesellschaftlich und kulturell für sich die Führung in Anspruch nimmt („Primat der Wissenschaft“). Passiert das zu oft, bahnt sich die Sehnsucht ihre eigenen Wege und das kann gefährlich werden. Das könnte übrigens ein Erklärungsansatz sein, warum die Verschwörungsmythen während der Coronakrise plötzlich so viel Beachtung fanden – letztendlich sind das ja auch Gestalten!
Dies ist der Punkt, an dem wir als Erzähler*innen unsere Verantwortung tragen müssen. Wenn wir mythische Geschichten erzählen, bieten wir eine Orientierung an. Das ist grundsätzlich in Ordnung, denn Mythen sind dazu da, Orientierung zu schaffen.
Das sollten wir aber auf keinen Fall mit einem Führungsanspruch verwechseln. Ein Mythos ist vergleichbar mit einem Kompass, dessen Nadel in eine bestimmte Richtung zeigt. Erstens hat der Kompass keinen Führungsanspruch; navigieren müssen wir schon selbst. Und zweitens zeigt seine Nadel auch nicht immer nach Norden, auch wenn das oft behauptet wird. In Wirklichkeit richtet sich die Kompassnadel an den Feldlinien des Erdmagnetfeldes aus. Und wer jemals versucht hat mit dem Kompass durch Island zu navigieren, weiß was hohe Breitengrade und vulkanische Aktivitäten mit der Kompassnadel anstellen.
Eine gerüttelt Maß an Vorsicht und Demut ist also in jedem Fall angebracht.
Und dennoch: Durch unsere Auseinandersetzung mit Mythen und mythischen Geschichten versuchen wir, so gut wir können, in der Gesellschaft nach Norden zu weisen.
Unser Werkzeug dafür ist die Sprache. Und an dieser Stelle kommen die Gestalten wieder ins Spiel. Wir versuchen mit der Sprache genau das Gleiche zu machen wie mit der Denkweise: Wir heben den Fokus auf.
Im Alltag sind wir gewohnt, logische Sprache zu benutzen, um einen Sachverhalt verständlich zu erklären. Wenn wir Mythen erzählen, benutzen wir symbolische Sprache, um auf etwas zu deuten, was sich mit Sprache nicht ausdrücken lässt, weil es begrifflich nicht fassbar ist. Beispielsweise kann ich mit dem Finger auf einen Berg zeigen, weil mein Arm nicht bis dort hin reicht – und mit deinem Blick bist du in der Lage, die Distanz zu überbrücken.
Kulturell bzw. gesellschaftlich neigen wir momentan eher dazu, auf den deutenden Finger zu starren, statt mit unseren Blicken der Richtung zu folgen, in die er zeigt. Doch die archetypischen Symbole haben eine eigenartige Kraft: Bis zu einem gewissen Grad sind sie in der Lage, den logischen Verstand zu umgehen und direkt mit unserer Seele zu sprechen.
Allen Verschwörungsmythen und allem medialen Rummel zum Trotz haben wir also gute Gründe zur Hoffnung, dass uns die Erzählkunst auch weiterhin begleiten wird.
Weiterführende Infos
- Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken. Frankfurt am Main 2020
- Hans-Peter Dürr: Die Zukunft ist ein unbetretener Pfad. Freiburg 1995
- Arne Næss: Die Zukunft in unseren Händen. Wuppertal 2013
- Fabian Scheidler: Der Stoff aus dem wir sind. München 2021
- David Abram: Im Bann der sinnlichen Natur. Klein-Jasedow 2015