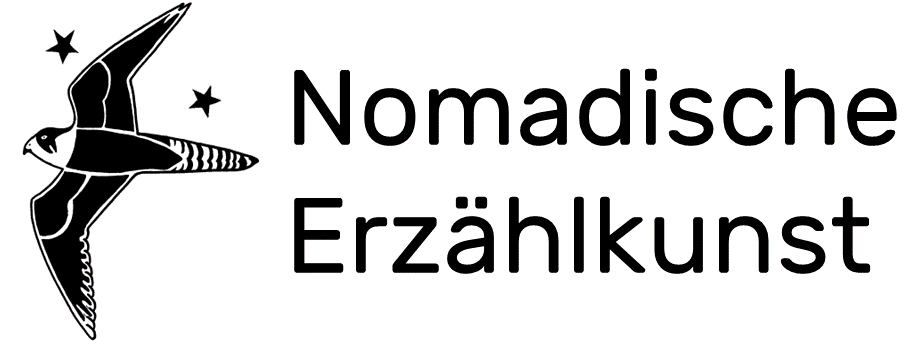Die Weitgereisten
Mitten im Zeitalter von Imperialismus und Kolonialismus gelang dem Ethnologen Adolf Bastian eine Entdeckung von großer Tragweite: In den Mythen verschiedenster Kulturen und Zeitalter entdeckte er erstaunliche Gemeinsamkeiten, die er als „Elementargedanken“ bezeichnete.
Der Begriff der Vernunft ist höchst ungeeignet,
Ernst Cassirer
die Formen der Kultur in ihrer Fülle und Mannigfaltigkeit zu erfassen.
Alle diese Formen sind symbolische Formen.
Deshalb sollten wir den Menschen nicht als animal rationale,
sondern als animal symbolicum definieren.
Die Herren Lüderitz und Woermann haben sich bestimmt einen Champagner gegönnt. Immerhin hatten sie Grund zum Feiern: Nach langen, mühsamen Verhandlungen hatten sie Bismarck 1884 endlich dazu gebracht, ihre „Besitztümer“ in Afrika unter den Schutz des Deutschen Reichs zu stellen. Das war auch dringend nötig: die Sicherheitslage gefährdete den Handel; diese ganzen Untermenschen gebärdeten sich geradezu, als ob das Land ihnen gehörte…!
Das also war das Ausmaß an Vernunft und humanistischen Werten, das knapp hundert Jahre nach der Epoche der vielgerühmten Aufklärung in der Elite der deutschen Gesellschaft angekommen war: Ein Zeitgeist, der im Wesentlichen aus dumpfer Gier, einem aufgeblasenen Ego und der Angst, nicht genug zu bekommen, bestand und ohne größere Umwege in den Ersten Weltkrieg führte.
Kaum zu glauben, dass ausgerechnet in dieser Zeit ein sehr wichtiger Gedanke in der Mythenforschung entwickelt wurde. Wir erinnern uns an den letzten Artikel (Die ewigen Lügengeschichten): Die Aufklärung hatte unter anderem die Entwicklung der wissenschaftlichen Arbeitsweise erheblich vorangetrieben. Derzufolge müssen Theorien oder Phänomene verifizierbar, falsifizierbar und reproduzierbar sein, damit sie wissenschaftlich untersucht werden können.
Diese Arbeitsweise auf Mythen anzuwenden war nicht so ganz einfach – vor allem, wenn man sie als „primitive Form des Denkens“ jener Völker verächtlich machte, die man mit wachsender Begeisterung im Zeitalter des Kolonialismus unterdrückte.
Absurderweise war es ausgerechnet der Kolonialismus, der europäischen Forschungsreisenden ungehinderten Zugang zu relativ entlegenen Erdteilen und Kulturen und damit auch Mythologien bot. Und wenn einer dabei war, dessen Beobachtungsgabe der Vernebelung durch den Zeitgeist einigermaßen widerstand, konnte er durch Vergleich der Mythen verschiedener Völker durchaus zu interessanten Erkenntnissen gelangen. Einer von diesen wenigen war der deutsche Ethnologe Adolf Bastian.
Im selben Jahr, als die Herren Lüderitz und Woermann den Kolonialismus sozusagen „offiziell“ in Deutschland einführten, erschien ein Buch namens „Allgemeine Grundzüge der Ethnologie“ von Adolf Bastian. Dieser war mit seinen inzwischen fast sechzig Jahren sehr weit in der Welt herumgekommen: Annähernd 25 Jahre hatte er (eigentlich als Schiffsarzt) auf Reisen verbracht und dann das berühmte „Museum für Völkerkunde“ in Berlin gegründet, das heute „Ethnologisches Museum“ heißt.
Bastian hatte die Mythen sehr vieler verschiedener Völker studiert und dabei war ihm aufgefallen, dass es gewisse Motive gab, die universell erschienen: sie tauchten in den Mythen der unterschiedlichsten Völker auf, und zwar unabhängig vom Ort und sogar unabhängig vom Zeitalter!
Diese Motive bezeichnete er als „Elementargedanken“. Allerdings waren diese Elementargedanken stets von kulturellen, lokalspezifischen Gewändern verhüllt: Natürlich tauchten in den indischen Mythen keine Eisbären auf, ebensowenig wie Tiger bei den Inuit im hohen Norden. Diese kulturellen Gewänder nannte Bastian „Völkergedanken“.
Für einen europäischen Forscher des 19. Jahrhunderts waren solche Überlegungen eine ungeheuerliche Leistung. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass diese Gedanken nicht mehr ganz taufrisch waren: In der indischen Philosophie wurde bereits seit ein paar Tausend Jahren zwischen mārga (der Pfad des Allgemeinen, also die Elementargedanken) und deshī (das Örtliche, also die Völkergedanken) unterschieden.
Jedenfalls wurde die Tragweite dieser Entdeckung in Europa zunächst nicht wirklich verstanden. Erst viel später griffen berühmte Ethnologen wie Malinowski und Lévi-Strauss seine Gedanken wieder auf. Inbesondere Lévi-Strauss stellte dann klar, dass der Mythos keine primitive Form des Denkens in Ermangelung wissenschaftlicher Methoden ist. Das magisch-bildhafte Denken ermöglicht ganz einfach andere Zugänge zu Erkenntnis als der wissenschaftliche Rationalismus.
Auch in der Archäologie wurde deutlich, dass man die Mythologien einer fremden oder alten Kultur kennenlernen und verstehen musste: Um rekonstruieren zu können, was sich in der Vergangenheit ereignet hat, brauchen wir oft mehr als ein paar Tonscherben.
In diesem Zusammenhang und mit dem entsprechenden Abstand wurde dann Bedeutung und Funktion der Mythen für die untersuchten Kulturen durchaus erkannt und gewürdigt. Allerdings hat das kaum dazu geführt, dass aktuelle Bezüge zu den Mythen oder zum mythischen Denken unserer eigenen Kultur hergestellt wurden.
In Berlin wurde 2012 eine Konferenz mit dem Titel „Animismus – Revisionen der Moderne“ organisiert. Der Journalist und Autor Rüdiger Sünner schreibt dazu:
„Immerhin stellte man vorsichtig die Frage, ob nicht auch andere, z. B. indigene Kosmologien einen ‚Anspruch auf Wirklichkeit‘ hätten und ob ein solches Zugeständnis nicht auch ‚Grundvorraussetzungen des modernen Denkens‘ erschüttern müsste.“
Allzu sehr hat man sich aber offenbar nicht erschüttern lassen. Das im letzten Artikel thematisierte Weltbild des kulturellen Mainstreams erfreut sich immer noch flächendeckender Verbreitung. Der Erfolg ist inzwischen nicht mehr ganz so flächendeckend. Man könnte fast sagen: Die Probleme häufen sich.
Wie dem auch sei: Animismus hat keinen guten Ruf in unserer Gesellschaft. Wenn du allerdings Mythen erzählen möchtest, solltest du mit dem Gedanken – besser noch mit der Erfahrung – vertraut sein, dass jedes Lebewesen, jedes „Ding“ auf der Welt eine Seele hat. Ansonsten werden die Geschichten – nunja, seelenlos.
Wir können also festhalten: In der Anthropologie wird die Bedeutung von Mythen durchaus erkannt und Mythen werden als „erhaltenswertes Kulturgut“ gewürdigt.
Aus erzählerischer Sicht müssen wir hier allerdings aufpassen: Wenn wir uns mit Mythen auseinandersetzen, haben wir nicht zwangsläufig die Erfahrung eines Adolf Bastian im Gepäck.
Viele alte Mythen, die heute noch erzählt werden, enthalten Symbole, die uns nicht unmittelbar verständlich sind. Sie stammen aus einer längst vergangenen Zeit und / oder aus Erdteilen, die uns keine Heimat sind. Die „Menschheitsgedanken“ sind noch da, und die können auch bei uns heutigen Menschen große Sehnsucht auslösen. Sie können aber nicht in dem Maß zur Orientierung verhelfen, wie sie das bei den Angehörigen jener Kultur und Epoche konnten, in der sie eigentlich entstanden sind.
Dennoch ist uns die Perspektive der Anthropologie beim Erzählen und Hören von Mythen aus verschiedenen Kulturen, Zeitaltern und Erdteilen eine große Hilfe. Sie entspricht dem uralten Gedanken des Spiegelns – dem Bedürfnis, sich mit dem scheinbar „Fremden“ zu konfrontieren, um darin erst die Konturen des „Eigenen“, dann des „universellen Menschlichen“ und schließlich des „Lebendigen an sich“ zu erkennen.
Weiterführende Infos
- Adolf Bastian: Ethnische Elementargedanken in der Lehre vom Menschen. Berlin 1895.
- Adolf Bastian: Allgemeine Grundzüge der Ethnologie. Berlin 1884
- Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken. Frankfurt am Main 2020
- Irene Albers, Anselm Franke (Hg): Animismus. Revisionen der Moderne. Zürich 2012