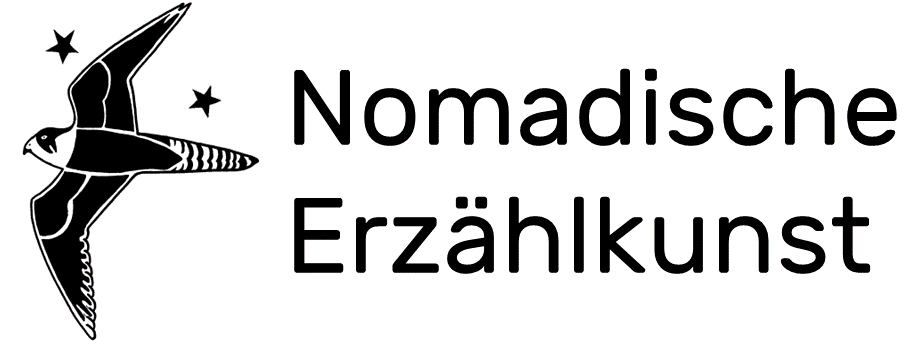Interkulturelles Erzählen
Gauri Raje arbeitet mit Migrant*innen und Asylsuchenden, um deren Ausdruckskraft in der für sie fremden Sprache Englisch zu stärken. Für Gauri ist das Erzählen eine radikale Form von Gemeinschaftskunst und damit viel mehr als nur Performance. Sie setzt sich intensiv mit den Phänomenen gegenseitiger Wahrnehmung beim mehrsprachigen Erzählen auseinander.
Gauri Raje – Mit dem Erzählen beginnen
Vielleicht ist die Faszination schon erwacht, als ich noch ein kleines Kind war und meine Großmutter mir Geschichten vorlas. Wahrscheinlich wurde sie dann genährt durch meinen Vater, der mir und meiner Schwester verschiedenste Geschichten erzählte. Jedenfalls waren Geschichten schon immer ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir diese Faszination je bewusst gewesen wäre – ich erinnere mich eher an ein Gefühl von Intimität beim Zuhören.
Bewusst wurde mir mein Interesse, als ich begann, Geschichte und Anthropologie zu studieren und meine Promotion über Narrative schrieb. Ich beschäftigte mich mit der Frage, inwiefern sich Mythen in einer Gemeinschaft über drei Generationen hinweg verändern. Da jede Generation die Welt anders erfährt, ändert sich auch ihre Art und Weise, ihre Mythen zu erzählen.
Mit anderen Worten: Die originären Mythen einer Gemeinschaft sind nicht statisch, sie ändern sich mit jeder Generation. Zum Ende dieser Arbeit hatte ich eine Menge Geschichten (persönliche und andere) und Mythen gehört – und das Gefühl ließ sich nicht länger unterdrücken: Womöglich wäre es viel spannender, Geschichten zu erzählen statt nur über Geschichtenerzählen zu schreiben.
Diese Neugierde brachte mich dazu, irgend so was wie „Storytelling“ in Google einzutippen und zu meiner Überraschung fand ich plötzlich zahlreiche Storytellingkurse in UK. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das Erzählen nur noch in oralen Kulturen in Asien, dem mittleren Osten oder einigen inidgenen Gemeinschaften lebendig ist. Offenbar bin ich mit ebenso so vielen Stereotypen über „den Westen“ aufgewachsen, wie ich Stereotypen über „indisch sein“ begegnet bin, als ich nach England kam! Jedenfalls interessierte mich diese zeitgenössische Erzählkultur in UK und infolgedessen belegte ich an der School of Storytelling einige Anfängerkurse.
Irgendwie fühlte es sich an, als hätte ich was zu sagen. So lernte ich nach und nach die Kunst des Geschichtenerzählens.
Das muss etwa fünf oder sechs Jahre gedauert haben, während derer ich zwei grundverschiedene Interessen zu balancieren hatte: Erstens arbeitete ich als Forscherin an der Universität, um meine Rechnungen bezahlen zu können und zweitens probierte ich so viele Arten und Weisen des Geschichtenerzählens aus, wie man sich nur vorstellen kann.
Als ich begann, mich als Freiwillige in der Arbeit mit Geflüchteten zu engagieren, traf ich eine Entscheidung: Ich gab meine Karriere an der Universität auf und nahm einen Job in einer Flüchtlingsorganisation an, die ein Lehrprogramm für Englisch und lokale Geschichte entwickelt hatte.

Einen gangbaren Weg finden
Beim Geschichtenerzählen ging es für mich schon immer darum, Menschen eine Stimme zu geben um sich ausdrücken zu können. Mir ging es nie um eine Performance. Und ich habe sehr intensiv mit der Idee gearbeitet, dass Erzählen eine Art der Kommunikation ist, selbst wenn die Geschichte in einer Sprache erzählt wird, die du nicht verstehst. ich habe wirklich hart daran gearbeitet, die Leute davon zu überzeugen, dass es bei einem Sprachkurs nicht nur darum geht, Englisch zu lernen, sondern zu lernen, wie man sich Englisch sprechenden Menschen verständlich machen kann. Es lässt sich nämlich immer ein Weg finden, die eigene Muttersprache zusammen mit Englisch zu verwenden und mit diesem „Hybriden“ erfolgreich zu kommunizieren.
Das war die Herangehensweise, als ich versuchte, mich mit Migrant*innen dem Thema Erzählen zu nähern. Das war auch die Idee, als ich damit begann, „Storytelling Lunch Circles“ anzubieten.
Allerdings stellte ich fest, dass die meisten Leute zwar gerne zum Mittagessen kamen, aber nicht zum Erzählen! Für die meisten Leute, die aus intakten „Erzählkulturen“ kommen, ist das Erzählen Teil der Lebenserfahrung. Und die Mittagessenszeit ist nicht gerade die Zeit, zu der sich Erwachsene hinsetzen und Geschichten erzählen. Geschichten werden normalerweise ganz entspannt am späteren Abend erzählt, wenn man Zeit hat und die Kinder im Bett sind.
Zu diesem Zeitpunkt waren mir die schottischen Ceilidhs noch unbekannt – eine lockeres Beisammensein, das diese Art und Weise des Erzählens eigentlich ziemlich gut getroffen hätte. Ich musste also eine Menge lernen und viele kleinere Schritte unternehmen, bis ich verstand, wie wichtig die Rolle ist, die der Rahmen spielt. Ist dieser stimmig, können durch Geschichten sogar politische Diskussionen geführt werden. Später hatte ich einige Teilnehmer*innen aus Simbabwe, die viele Märchen erzählten – doch alle anderen verstanden nur zu gut, dass sie damit eigentlich über Mugabe redeten oder über Kolonialismus oder andere scheußliche Themen: Geschichten waren zu einer gemeinsamen Sprache geworden, in der die Leute ihre Sorgen und Nöte teilen konnten.
Bevor ich das Erzählen erstmals im Lernprozess einsetzte, lief das Training viel formeller und mehr im Klassenraum ab. Allerdings hatten die meisten Geflüchteten oder Asylsuchenden schon von Shakespeare gehört – Geschichten aus England bedeuteten für sie zunächst einmal, nach Stratford-upon-Aven zu gehen, dem Geburtsort von Shakespeare. Und praktischer Weise fanden die Trainings in Birmingham und Coventry statt, also ganz in der Nähe. Die ersten Erzählversuche fanden also in Stratford-upon-Aven statt, wo wir Shakespeare-Texte lasen und Comics, die aus Shakespeare-Aufführungen entstanden waren, wo wir uns die Häuser und Statuen anschauten und dann darüber sprachen. Später dehnten wir das auf Coventry und Umgebung aus. Dort gibt es vieles zu erzählen, denn Coventry ist ein Ort mit sehr reicher und spannender Historie.

Erzählen als Aktivismus
Nach einiger Zeit verstand ich die Bedürfnisse der Leute, mit denen ich arbeitete, besser. Das war die Zeit, in der mein Engagement im Erzählen begann, sich mit meiner politischen Einstellung zu Migrationsthemen in UK zu überlappen.
Wenn du einen Antrag auf Asyl bei der Einwanderungsbehörde stellst, werden dir eine Reihe von Fragen gestellt, deren Antworten darüber entscheiden, ob du wirklich Asyl benötigst. Du bekommst Asyl, wenn deine Geschichte glaubwürdig erscheint. Das heißt, von Anfang an machen sich die Leute Gedanken darüber, wie sie ihre Geschichte so erzählen können, dass sie den Behörden glaubwürdig erscheint. Das hat mit ihren Erfahrungen, mit ihrer tatsächlichen Lebensgeschichte nicht allzu viel zu tun, weil die Emotionen fehlen.
Ich stellte fest, dass ein Asylverfahren eine Dauer von zwei bis zehn (!) Jahren hat – ein Zeitraum, in dem du dieselbe Geschichte immer und immer wieder aufs Neue erzählen musst. Und wenn du das tust, wird sie sich nach und nach in dein Leben schleichen und zu deiner wirklichen Lebensgeschichte werden. Faktisch. Ohne Emotionen. Ohne Widersprüche.
Um es kurz zu machen: Dein Asylantrag ist echt, wenn du zeigen kannst, wie sehr du Opfer bist, und nicht wie sehr du nach all deinen Erlebnissen noch immer Mensch bist. Was ich entdeckte, war folgendes: Wenn die Leute wirklich erfolgreich waren und ihren Asylstatus erhielten, traten sehr oft Symptome von PTSD (Posttraumatische Belastungsstörungen) auf. Zu einem Zeitpunkt, wenn sie sich schließlich und endlich hätten sicher fühlen können, fühlten sie sich unsichersten! Das lag offenkundig daran, dass sie keine Gelegenheit hatten, sich emotional mit ihrer tatsächlichen Geschichte auseinanderzusetzen.
Die Frage, wie man eine Geschichte erzählt, hatte sich für mich in politischen Aktivismus verwandelt.
Ich versuchte nun, einen alternativen Raum zum Geschichtenerzählen erschaffen. Abseits der Geschichten, die den Behörden erzählt wurden, hatte man die Möglichkeit, in den Workshops, die ich hielt und in den abendlichen Erzählveranstaltungen, die ich ausrichtete, über das zu sprechen, was ich „das Unerhebliche“ nenne, die kleinen Dinge. Wann hast du zum ersten Mal Erleichterung gespürt, als du dein Zuhause verlassen hast? Welches war dein erster Job? Was war das erste das du sahst, als du in einem unbekannten Haus aus dem Fenster schautest?
Diese Fragen und die daraus resultierenden Geschichten mögen simpel erscheinen, aber sie beziehen die Sinne mit ein, nicht die Fakten. Ich versuchte einen Raum zu schaffen, in dem die Leute Freude und Erstaunen ausdrücken konnten und wo sie einfach als Menschen wahrgenommen werden konnten – als Menschen, die sich ausdrücken. Ich denke, die Idee, aus Freude Geschichten zu erzählen ist ein politischer Akt für Menschen, denen es nicht erlaubt ist, Freude auszudrücken.
Brexit als Änderung des politischen Klimas
Mit dem Brexit-Referendum 2016 änderten sich die Dinge in eine für mich beunruhigende Richtung. Als dunkelhäutige Person konnte ich die wachsende Feinschaft in Birmingham spüren. Das Klima war nicht mehr davon geprägt, eine gemeinsame Basis zu finden, sondern bewegte sich eindeutig in Richtung Polarisierung. Meinem Mann und mir ging es gut genug – wir hätten es ignorieren können, hätten damit leben können. Aber beide spürten wir, dass das beim besten Willen nicht die Art und Weise war, wie wir unser Leben leben wollten – ständig auf Feindseligkeiten zu reagieren.
Auf die eine oder andere Weise gab der Brexit also den Ausschlag, Birmingham zu verlassen und nach Glasgow zu ziehen. Erst war es ein Versuch, aber mein Mann wollte ein Sabbatjahr machen und verliebte sich dann beim Wandern in die schottischen Landschaften und ich fand schnell einen Job. Also entschlossen wir uns, zu bleiben.
Schottland war in vielerlei Hinsicht deutlich entspannter in Migrationsfragen. Mein erster Job war ein Vertrag für ein Jahresprojekt bei einem Radiosender zum Thema Arbeit mit den Lebensgeschichten älterer Migranten, die in den 1950er und 60er Jahren aus Südostasien gekommen waren. Das klingt vielleicht ein bisschen historisch, aber die Migranten, die damals aus Indien, Pakistan oder Bangladesh kamen, haben eine Menge mit den Asylsuchenden von heute gemeinsam, die aus dem Sudan, Eritrea, Syrien, dem Irak usw. kommen: Sie alle versuchten, der Gewalt in ihren Heimatländern zu entkommen und flüchteten, oft unter traumatischen Umständen, nach UK. Es mag Migranten aus Südostasien geben, die hier seit 50 Jahren leben, aber viele von ihnen sind in der Endlosschleife eines nicht anerkannten Traumas gefangen.
Das ist ein großer Unterschied zu Leuten wie mir. Ich bin ja auch Migrantin. Aber als wir in den 1990ern ins Vereinigte Königreich kamen, waren wir privilegierte Migranten – wir kamen mit Fähigkeiten, wir konnten lesen und schreiben! Migration kann viele sehr verschiedene Erfahrungen umfassen. Besonders in UK hören wir nur bestimmte Arten von Geschichten über südostasiatische Migranten: die Geschichten von Männern. Männer, die aufstiegen, die reich und erfolgreich waren und dann Politiker wurden. Wir hören keine Geschichten von analphabetischen Frauen, die als Bräute kamen und hier zum ersten Mal ihren Mann trafen und keine Freundinnen hatten. Wir hören keine Geschichten von Leuten, die es mit viel Mühe irgendwann schafften, als Lehrer*innen zu arbeiten, oder als Busfahrer*in oder in einem ungelernten Handwerksjob. Sie mögen es geschafft haben, in die Mittelklasse aufzusteigen, aber das ist nicht sexy genug – also werden ihre Geschichten nicht gehört.

Lernen, sich zu beheimaten
Und doch gibt es etwas sehr Bemerkenswertes in den Geschichten dieser Menschen: Sie haben mehr als 50 Jahre Erfahrung damit, in einem fremden Land eine Heimat zu finden. Der einzige Weg, einen Ort wirklich kennenzulernen, führt über die sinnliche Wahrnehmung. Also begann ich mich für die Fragen zu interessieren, wie sie es schaffen, sich zu beheimaten und was ihnen Heimat eigentlich bedeutete. Man kann so vieles von dieser Generation lernen!
Die Kinder und Enkelkinder dieser Migranten sind hier geboren und aufgewachsen. Sie sprechen Englisch, aber einige von ihnen haben keine Beziehung mehr zur Sprache ihrer Eltern, was einen tiefen Graben aufreißt. Die Alten können manchmal nicht mehr mit ihren Enkelkindern reden, weil sie kein Englisch sprechen. Und die zweite Generation ist so beschäftigt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und sich zu etablieren. Sie haben keine Zeit, sich hinzusetzen und die Geschichten ihrer Eltern zu hören.
Doch als wir eine Austellung über die biografischen Geschichten dieser älteren Migrantinnen machten, kamen sie in Begleitung ihrer Kinder und Enkelkinder. Und als diese die Tafeln sahen und die Geschichten lasen, hatten sie plötzlich einen Ansatzpunkt, ihren Eltern Fragen zu stellen, was zu einer neuen Art intergenerationaler Unterhaltung führte. Manchmal öffneten Geschichten die Tür, sich wieder miteinander zu verbinden und dann konnten überraschende Dinge passieren. Als ich mit den älteren Migrant*innen arbeitete, erfuhr ich von der unglaublichen Kultur des Dichtens. Sie mögen früher Busfahrer, Ladenbesitzer oder Hausfrauen gewesen sein, aber sie schrieben Gedichte in ihre Tagebücher. Wundervolle Gedichte!
Ihre Kinder hatten nicht die leiseste Ahnung davon. Die betrachteten ihre Eltern als analphabetische, Urdu sprechende, geistig zurückgebliebene Alte. In Wirklichkeit haben die nach ihren 17-Stunden-Schichten Gedichte in ihre Tagebücher geschrieben…
Die älteren Migrant*innen wissen noch, was eine orale Kultur, eine Erzählkultur wirklich ausmacht, weil sie in einer solchen aufgewachsen sind. Sie haben das gewissermaßen in ihren Knochen verinnerlicht, was ihre Kinder und Enkelkinder nur noch als Performance wahrnehmen können. Für die älteren Migranten geht es darum, wie man sein Leben lebt: Man moralisiert nicht, man erzählt Geschichten. Durch Geschichtenerzählen sprichst du nicht über Gesetze, sondern über die verschiedenen Arten und Weisen, die Dinge zu tun.
Es gibt hier Leute, die wissen, worum es beim Geschichtenerzählen geht; man muss sie nur fragen – und ich bin froh, dass ich das Glück hatte, diesen Dialog ermöglicht zu haben.
Die Zukunft des Erzählens
In diesem Sinne hoffe ich, dass Erzählen zum integralen Bestandteil der Kultur wird und nicht nur eine Form der Performance. Die Menschen würden einander besser zuhören und das würde zu etwas mehr Liebenswürdigkeit im Umgang miteinander führen. Sie würden zwar festhalten an dem, woran sie glauben, aber zugleich würden sie lernen, den Geschichten der anderen zuzuhören, weil sie genau wüssten, wie wichtig es für ihre eigene Geschichte ist, gehört zu werden.
Es wäre einfach ein guter Weg, die scharfen Ecken und Kanten des Lebens abzuschleifen, die wir besonders in UK nach dem Brexit erlebt haben. Und ich glaube, die Leute würden nicht mehr so sehr über ihre individuellen Rechte sprechen, sondern mehr über die Art und Weise des Miteinanderseins: Gemeinschaft erschaffen und zugleich verschiedene Standpunkte würdigen.
Weiterführende Infos
- Gauri führt ein ausführliches Profil auf LinkedIn